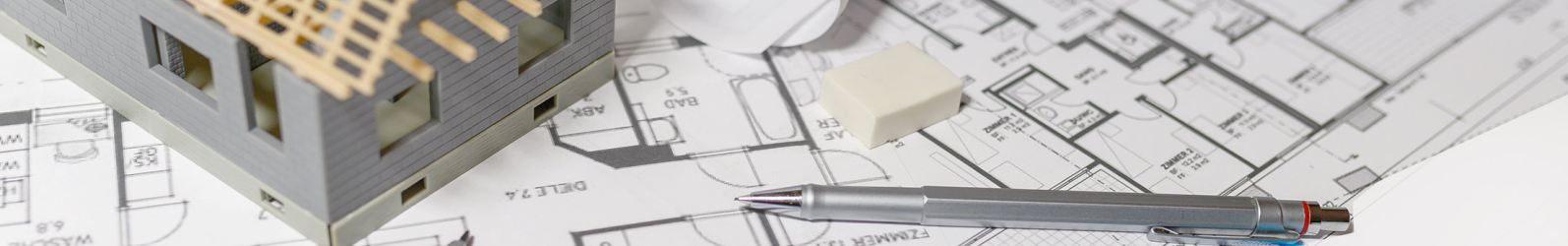Inhaltsbereich
Wohnungs- und Mietrecht
Wir überwachen die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für Sozialwohnungen in Brüggen, Grefrath, Schwalmtal und Niederkrüchten. Aufgaben sind unter anderem:
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS)
- Erteilung von Bezugsgenehmigungen
- Erteilung von Zinsbescheinigungen Einhaltung von Mietpreisvorschriften
- Mietfestsetzungen nach Modernisierungen
Nähere Auskünfte hierzu geben Ihnen Ihre Ansprechpartner für die Dienstleistung "Wohnberechtigungsschein".
Kostenmiete
Im Rahmen der Wohnraumförderung für die Modernisierung von Mietwohnraum wird zur Sicherung sozialverträglicher Mieten die sogenannte Kostenmiete angewendet. Sie legt fest, in welcher Höhe Vermieterinnen und Vermieter die Miete nach einer geförderten Modernisierung verlangen dürfen.
Die Kostenmiete orientiert sich an den tatsächlich entstehenden Aufwendungen für die förderfähigen Modernisierungsmaßnahmen. Dazu zählen zum Beispiel Bau- und Finanzierungskosten, Verwaltungskosten sowie laufende Instandhaltung. Die Höhe der zulässigen Miete wird auf Basis gesetzlicher Regelungen und unter Berücksichtigung der öffentlichen Förderung berechnet.
Ziel ist es, auch nach einer umfassenden Modernisierung bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen und dabei eine wirtschaftlich tragfähige Vermietung zu ermöglichen. So profitieren sowohl Mieterinnen und Mieter als auch Eigentümerinnen und Eigentümer von der öffentlichen Förderung.
Häufig gestellte Fragen zur Kostenmiete
Warum wird eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt?
Für welche Wohnungen ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen?
Was muss eine Wirtschaftlichkeitsberechnung beinhalten?
Was zählt zu den laufenden Aufwendungen?
Wie oft ändern sich die Verwaltungskosten (§ 26 II. BV) und die Instandhaltungskosten (§ 28 II.BV)?
Bei weiteren Fragen zum Thema Wohnraumförderung wenden Sie sich bitte an wohnraumfoerderung@kreis-viersen.de.
Dienstleistungen
Kontakt
-
60/3 Rechtliche Bauaufsicht, Wohnungsbauförderung
Servicezeit:Montag: 8:00-17:00 Uhr
Dienstag: 8:00-17:00 Uhr
Mittwoch: 8:00-17:00 Uhr
Donnerstag: 8:00-17:00 Uhr
Freitag: 8:00-17:00 Uhr